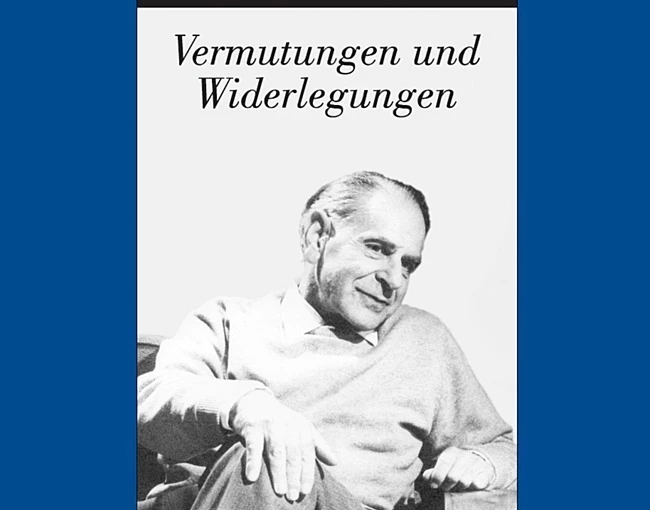Der kritische Rationalismus ist zunächst keine abgegrenzte Lehre, sondern eine Haltung. Die Haltung, dass wir durch Kritik der Wahrheit näher kommen können. Wir finden sie in der gesamten Geschichte, etwa bei Sokrates, bei den Skeptikern, den Humanisten und natürlich bei den Aufklärern. Karl Popper (1902-1994) beschreibt sie so:
„…vielleicht habe ich unrecht, und du hast recht, jedenfalls können wir beide hoffen, nach unserer Diskussion etwas klarer zu sehen als vorher, und jedenfalls können wir beide voneinander lernen, solange wir nur nicht vergessen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer recht behält, als vielmehr darauf, der Wahrheit näherzukommen. Nur zu diesem Zweck verteidigen wir uns in einer Diskussion so gut, wie wir eben können.“ („Alles Leben ist Problemlösen“ 161. – Empfehlung zum Einstieg)
Der klassische Rationalismus geht davon aus, dass das Denken der Wahrnehmung immer schon voraus geht. Dass also in jeder Wahrnehmung schon Denken drinsteckt. Als Beispiel kann vielleicht der tägliche Sonnenaufgang dienen. Die Wahrnehmung scheint klar zu sein und man bemerkt gar nicht, dass das Denken schon drinsteckt. Aber man kann die Sache auch anders denken und damit anders „sehen“: die Erde dreht sich vor der Sonne hinab.
Diese Durchdringung unserer Wahrnehmungswelt mit vorbewussten und vielfach fehlerhaften Annahmen soll durch Vernunftgebrauch aufgeklärt und richtiggestellt werden. Dabei müssen wir uns gegenseitig durch das kritische Gespräch helfen, die Irrtümer und Lücken in unserer Erkenntnis und in unseren Entscheidungen zu beseitigen.
Auf die metaphysischen Letztbegründungen des Rationalismus verzichtet der kritische Rationalismus weitgehend. Er geht vom Gegebenen aus und gibt sich mit schrittweisen Verbesserungen zufrieden. Das gilt für unser Erkennen, also die Wissenschaft, und es gilt für unser Handeln, also die Moral und die Politik.
„Wahrheit“ ist einer der zentralen Begriffe des kritischen Rationalismus. Von der Wahrheit meinen heute ja viele zu wissen, dass es sie nicht gäbe. Aber sie halten ihren Satz „die Wahrheit gibt es nicht“ doch auch für wahr. Irgendwie scheint es die Wahrheit dann doch zu geben.
Es mag zwar kein abgegrenztes Objekt geben, das man als „die Wahrheit“ bezeichnen kann, das heisst aber nicht, dass keine Wahrheit sei. Allerdings müssen wir in der Wissenschaft vorsichtig mit der Behauptung sein, dass wir die Wahrheit gefunden haben. Denn letztlich bleibt alles nur Vermutung, wie Karl Popper sagt.
Anstelle also letztgültig die Wahrheit in Besitz zu nehmen, oder dem Menschen die Wahrheitsfähigkeit abzusprechen, erinnert uns der kritische Rationalismus an eine Unterscheidung, die wir schon bei Lessing finden, dass nämlich Wahrheitssuche geboten ist, aber Wahrheitsbesitz zu meiden.
Die Wahrheit IST also, indem sie unser Denken reguliert, ohne selbst als abgegrenztes Objekt zu erscheinen. „Der Wahrheitssucher ist in fast derselben Lage wie ein Segler, der … genau nach Süden will. Er muss seine Richtung dauernd korrigieren und sie weicht fast immer vom Südpunkt ab. Aber der Südpunkt ist absolut – auch wenn der Kurs nur selten ganz richtig ist und oft genug … abweicht. Genauso geht es uns mit der Fehlerkorrektur in unserer Suche nach der Wahrheit.“
Mit dieser Unterscheidung von Wahrheitssuche und Wahrheitsbesitz kam die wissenschaftliche Welt in große Schwierigkeiten. So schreibt 1967 die Encyclopedia of Philosophy zu seiner Verwunderung über Karl Popper, dass für ihn „die Wahrheit selbst nur eine Illusion“ sei. Er selbst hingegen sagt ganz deutlich: „Die Wahrheit ist objektiv und absolut…Aber wir können niemals ganz sicher sein, dass wir die Wahrheit, die wir suchen, gefunden haben.“ [1]
„Ich erkannte, dass die Suche nach Rechtfertigung aufgegeben werden muss, nach Rechtfertigung des Wahrheitsanspruches einer Theorie. Alle Theorien sind Hypothesen; alle können umgestoßen werden.
Auf der anderen Seite war ich weit davon entfernt vorzuschlagen, die Suche nach Wahrheit aufzugeben: Unsere kritischen Diskussionen der Theorien sind von dem Gedanken beherrscht, eine wahre (und leistungsfähige) erklärende Theorie zu finden; und wir rechtfertigen unsere Bevorzugung durch Berufung auf die Idee der Wahrheit: sie spielt die Rolle einer regulativen Idee. Wir prüfen auf Wahrheit, indem wir das Falsche ausscheiden.“ (Objektive Erkenntnis, „Vermutungswissen“ 1967)
Der wissenschaftliche Fortschritt wird also durch zwei Prozesse erreicht, durch „kühne Vermutungen und (durch) erfinderische und ernsthafte Versuche, sie zu widerlegen.“ (O.E.). Die Hypothesen sollen durchaus „mutig“ und „phantasievoll“ sein, um Poppers Worte zu verwenden, allerdings müssen sie so formuliert sein, dass sie überprüfbar und widerlegbar sind.
Wenn wir also in der Zeitung lesen, dass Innsbruck im Jahre 2070 mit 37 anstatt 12 Hitzetagen pro Jahr zu rechnen habe, wenn die Klimamaßnahmen scheitern[2], so ist diese These noch nicht überprüfbar formuliert. Im Sinne des kritischen Rationalismus handelte es sich dabei um keine wissenschaftliche Aussage, wenn sie nicht zusätzlich so heruntergebrochen wird, dass sie empirisch widerlegbar wird.
Positive Belege lassen sich für jede Hypothese finden. Was aber nicht heisst, dass die Hypothese nicht zugleich auch Irrtümer enthält, mitunter schwerwiegende. Deshalb meint der kritische Rationalismus, dass sogenannte Beweise für eine Theorie keinen wissenschaftlichen Wert haben. Widerlegungen hingegen schon.
Das ist also die sogenannte Falsifikationstheorie des kritischen Rationalismus. Popper illustriert sie am Beispiel des schwarzen Schwanes. Wenn ich sage, alle Schwäne sind weiss, so werde ich wohl einige oder gar sehr, sehr viele Belege dafür finden. Das heisst aber nicht, dass es keinen schwarzen Schwan gibt. Finde ich nur einen schwarzen, so ist die Theorie widerlegt.
Als positives Beispiel führt Popper die Widerlegung einiger Teile von Newtons Gravitationstheorie durch Einstein an, die davor über 200 Jahre für unumstößlich wahr gehalten wurden. Einstein selbst hingegen hat seine auf Newton aufbauende aber weiter fortgeschrittene Relativitätstheorie immer als eine Theorie bezeichnet. Als eine Hypothese, mit deren Widerlegung er selbst auch zu Lebzeiten noch rechnete und an deren Widerlegung er höchstes Interesse hatte. Hätte 1919 bei einer Sonnenfinsternis der empirische Beweis erbracht werden können, dass das Sternenlicht doch nicht von der Masse der Sonne abgelenkt wird, so hätte Einstein seine Theorie zurückgezogen. Aber sie hielt dieser empirischen Überprüfung stand und ist jetzt als wissenschaftliche Hypothese zu bezeichnen, die noch nicht widerlegt wurde und die sich in einem Widerlegungsversuch „bewährt“ hat. Dahinter hören wir Darwins Idee der natürlichen Auslese durch: Die besten Ideen überleben deren Widerlegungsversuche.
Von bewiesenen Wahrheiten kann in der Wissenschaft deshalb keine Rede sein, sondern nur von Theorien, die sich in Widerlegungsversuchen „bewährt“ haben, die sich dem harten Daseinskampf ums Überleben ausgesetzt haben. Dies ist für Popper das bessere Abgrenzungskriterium gegenüber Pseudowissenschaft und Metaphysik, als die seit Francis Bacon übliche empirische Verifikation.[3]
Eine Wissenschaft, die sich nicht diesem strengen Kriterium unterwirft, konnte und kann für alle möglichen Interessen missbraucht werden. Es darf vermutet werden, dass dies beim größeren Teil aller Forschungen immer noch der Fall ist.
Damit habe ich schon die Brücke vom wissenschaftlichen zum politischen Feld geschlagen. Die Idee der Offenen Gesellschaft beruht nicht auf der Auswahl der besten Regierenden, sondern auf deren gewaltfreien Abwählbarkeit – analog zur Falsifikation von Hypothesen. Die Politik entwickelt ebenso Hypothesen, diesmal aber solche, die das Handeln betreffen. Und diese Hypothesen müssen sich der Kritik durch unabhängige Institutionen stellen. Deshalb ist die Gewaltenteilung so wichtig für eine Demokratie.
Zu diesen Institutionen gehört neben dem Parlament der ganze geistige Bereich einer Gesellschaft, also Wissenschaft, Kultur und Medien und insbesondere unabhängige Gerichte. Der Sinn des Verfassungsgerichtshofes ist ja der Schutz der Menschen vor Übergriffen durch ihre Regierung, weshalb hier größte Unabhängigkeit zu herrschen hätte. Denn die Tendenz ihre Macht immer weiter auszudehnen, möglicherweise bis hin zur totalitären Herrschaft, liegt durchaus im Wesen jeder Regierung.
Also nicht die Auswahl der Besten sorgt für eine gute Regierung, sondern deren kritische Überwachung und Korrektur durch unabhängige Institutionen. Die Methodik zum Aufrechterhalten einer offenen Gesellschaft liegt deshalb darin, dass wir die Mechanismen von Kritik und Verbesserung ständig lebendig halten und noch weiter ausbauen.
Zur Verteidigung der offenen Gesellschaft genügt es nicht, sich über Orban oder die AfD aufzuregen. Solche stereotypen Feindbilder werden heute auch benutzt, um nicht über die eigenen Fehler und inneren Unstimmigkeiten sprechen zu müssen und seine Projektionen irgendwo abladen zu können.
Eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen müsste in einer offenen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Dasselbe gilt für die Folgen der energiepolitischen Entscheidungen der letzten Jahre, für die Folgen der Migrationspolitik und auch für die Folgen der Russlandsanktionen.
Jedes Hinwegducken unter solche kritischen Lernprozesse schwächt die Offene Gesellschaft und riskiert einen Rückschritt in eine vordemokratische Herrschaftskultur, zu der wir Menschen durchaus unbewusste Neigungen haben.
Unabhängige Institutionen, Meinungspluralismus und ein herrschaftsfreier Diskurs sind die Grundpfeiler der Offenen Gesellschaft. Wenn Medien, Wissenschaft und Gerichte unter den Einfluss der Regierungen geraten, ist die Gesellschaft ernsthaft bedroht. Die fallweise Weisungsgebundenheit und die politische Besetzung von Gerichten sind deshalb eine große Gefahr. Ebenso Medien, auf die Regierungen direkt Einfluss nehmen, oder indirekt durch Subventionen. Und als drittes ist die universitäre Forschung in der EU zunehmend in die Abhängigkeit von Drittmitteln getrieben worden, und ist damit zur interessensgeleiteten Forschung genötigt, während die kritische Forschung und die Grundlagenforschung immer mehr erodieren.
Die Offene Gesellschaft baut zwar auf Demokratie auf, geht aber über diese hinaus. Die Demokratie garantiert noch keine offene Gesellschaft, weil auch sie ins Totalitäre kippen kann, indem sie die Unabhängigkeit der korrigierenden Institutionen untergräbt und immer mehr eine „Tyrannei der Mehrheit“ ausübt (Toqueville).
Die Mehrheiten wurden schon immer durch Heilsversprechen (Utopien) der Mächtigen manipuliert, heute vielleicht mehr durch Unheilsversprechen (Dystopien). Karl Popper hat eindringlich vor dieser Gefahr gewarnt:
„Wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück stürzen wollen, müssen wir unsere Träume der Weltbeglückung aufgeben.“ (EdH) „Arbeite lieber für die Beseitigung von konkreten Mißständen als für die Verwirklichung abstrakter ldeaIe. … Das Elend ist konkret, die Utopie abstrakt. … Keine Generation darf zugunsten zukünftiger Generationen geopfert werden, zugunsten eines Ideals, das vielleicht nie erreicht wird. … Der Zauber und der Reiz, den die Zukunft auf den Utopismus ausübt, hat nichts mit rationaler Voraussicht zu tun.“ („Über Utopie und Gewalt“ in „Vermutungen und Widerlegungen)
„Dennoch können und sollen wir Weltverbesserer bleiben. Wir müssen uns mit der nie endenden Aufgabe begnügen, Leiden zu lindern, vermeidbare Übel zu bekämpfen und Mißstände abzustellen; immer eingedenk der unvermeidbaren ungewollten Folgen unseres Eingreifens, die wir nie ganz voraussehen können…“ (Das Elend des Historizismus, Tübingen (Mohr/ Siebeck) 1979, S. VIII.)
Die vielfältigen Implikationen und der Nutzen für die Organisationsentwicklung werde ich folgen lassen, falls ich Lust und Zeit habe.
Literaturempfehlung:
- Karl Popper „Alles Leben ist Problemlösung“ (Einsteiger).
- Karl Popper „Vermutungen und Widerlegungen“ (Fortgeschrittene)
[1] (Objektive Erkenntnis, darin „Vermutungswissen“, 1984 4.Auflage. vgl. auch Fußnote)
[2] „Innsbruck wird Hitzepol Österreichs“ „Was ein Scheitern des Klimaschutzes für Österreich bedeuten würde, zeigen Modellrechnungen des Climamap-Projekts….“ Tiroler Tageszeitung am 14.12.23
[3] vgl. z.B. „Ausgangspunkte – meine intellektuelle Entwicklung“ 108